Mein Auto, das Leichtgewicht
Bereits vor über siebzig Jahren stellte Henry Ford sein „Hanf-Auto“ vor. Durch das Verbauen von Naturfasern war das Modell leichter als seine Pendants aus Stahl und dennoch stabil. Geringes Gewicht bedeutet zudem einen niedrigen Treibstoffverbrauch. Anscheinend hat man sich bei Lotus daran erinnert.
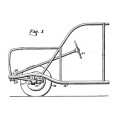
Der britische Autohersteller hat Hanf für sich entdeckt: Bei seinem Prototyp Eco Elise bestehen Teile der Karosserie aus Hanffasern, wie » Spiegel online berichtet. Bereits 1941 stellte Henry Ford sein als „Hanf-Auto“ bekannt gewordenes Modell der Öffentlichkeit vor. Die Karosserieflächen waren aus Pflanzenfasern gefertigt. Deren genaue Zusammensetzung ist allerdings unbekannt.
Pflanzenfasern bringen etliche Vorteile im Fahrzeugbau mit sich: Sie sind nicht nur besonders stabil und deutlich leichter, sondern auch sicherer, da bei Brüchen keine scharfen Kanten entstehen. Außerdem lassen sich diese Fahrzeugteile umweltschonend recyceln. Dennoch sind Pflanzenfasern bisher weitgehend unbeachtet. Gründe dafür sind ein zu geringes Angebot an Zulieferern und fehlende Forschungsmittel für den optimierten Einsatz von Hanf & Co.
Autoteile aus Pflanzen: Mobilität von morgen
Zwar machen sich zahlreiche Wissenschaftler, Verkehrsplaner und Ingenieure darüber Gedanken, wie wir den Waren- und Personenverkehr in Zukunft gestalten wollen. Doch vieles bleibt Stückwerk. Ein Gedanke ist, verstärkt auf Elektroautos zu setzen, um unabhängiger vom Erdöl zu werden. Während Elektrofahrzeuge besonders von der Leichtbauweise profitieren, steckt immer noch eine große Menge Erdöl in ihnen: (globaler) Transport der einzelnen Teile, Kunststoffe und Reifen.
Und ist es wirklich sinnvoll, dass Millionen von Fahrzeugen die Straßen verstopfen und Hunderte von Quadratkilometern Parkplätze benötigen? Besonders im Hinblick darauf, dass in Westeuropa längst mehr Autos produziert als benötigt werden, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung Anfang April berichtete. Die hiesigen Märkte sind schon lange gesättigt. Dennoch entstehen weltweit neue Fabriken, die laut Zeitung aber nicht nur für den Aufschwung, sondern auch für die Verdrängung anderer Marken gebaut werden. Das Carsharing, also das gemeinsame Nutzen von Fahrzeugen, ist ein zögerlicher Anfang das Paradigma des eigenen Autos zu brechen.
Im ersten Equilibrismus-Roman „Das Tahiti-Projekt“ kombiniert Autor Dirk C. Fleck die Vorzüge von Individual- und öffentlichem Verkehr. Der „Reva-Tae“ ermöglicht in der Fiktion auf Tahiti die Fahrt von A nach B ohne Zwischenstopp. Die Kabinen des elektrisch betriebenen Verkehrsmittels bestehen aus Pflanzenfasern, laufen auf Schienen und Fahrziele können individuell gewählt werden. Ist dieses Modell auch im Autoland Deutschland denkbar? Was glauben Sie: Wie werden wir unsere Mobilität künftig gestalten?









